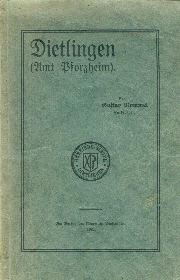Kirche und Pfarrei (Einleitung)
Die im alten Friedhof stehende und erhöht über dem Dorf gelegene Kirche stellt mit den sie umgebenden Befestigungsmauern heute noch eine der besterhaltenen Kirchenburgen unseres Landes dar.

Abbildung 10 - Dorfplatz
Die Tatsache, daß in der Kirchenwand Jahrhunderte lang die schon erwähnten beiden römischen Reliefsteine eingemauert waren, lassen die Annahme zu, daß der Remberg vorgelagerte Kirchenhügel, unmittelbar über dem Tal und an der römischen Zweigstrasse gelegen, vielleicht einst ein römisches Gebäude oder Heiligtum trug. Die heidnischen Germanen mieden im allgemeinen bei ihrer Zuwanderung die von den Römern verlassenen Siedelungen, bei der Christianisierung des Landes aber errichteten die Missionare häufig gerade auf römischen Trümmern oder heidnischen Kultstätten das christliche Kreuz oder bauten Kirchen dahin.

Abbildung 16 - Kirche mit Kriegerdenkmal
Jedenfalls war der heutige Kirchenhügel schon den ersten Ansiedlern ein wichtiger Ort, den sie wahrscheinlich auch als Totenbegräbnisplatz und (außer dem Ringwall auf der Remberghöhe) als Verschanzungsort gegen feindliche Überfälle benützten. So blieb es auch weiterhin in die spätere Zeit hinein, als eine Kirche dort erstand und die ganze Anlage im Mittelalter durch hohe Befestigungsmauern in ihrer Wehrhaftigkeit noch mehr vervollkommnet wurde.
Die Befestigungen um die Kirche
Fast kreisrund geht das starke Mauerwerk um die Kirche, den alten Friedhof miteinschließend. Von Norden her führt die Kirchstaffel auf 23 Stufen an das spitzbogige Eingangstor in der Wehrmauer. Gegen die Dorfseite (Westen) nach der Straße ist der steil abfallende Kirchenhügel durch etwa 8 - 10 Meter hohe Mauern mit Streben aufgemauert, die heute zum Teil erneuert sind.
Die den Berg hinanführenden Umfassungsmauern haben zwar ihre ursprüngliche Höhe nicht mehr, doch sind die Reste immerhin nach 5 bis 6 Meter hoch. Die ehemaligen Mauerbekrönungen, die Zinnen, sind auf etwa 1 Meter eingestürzt. Der innere staffelförmig auf- und absteigende Wehrgang ist verhältnismäßig gut erhalten. Die Gangplatten gehen durch das ganze Mauerwerk hindurch, ihre Führung ist auch auf der Außenseite wahrnehmbar. Größere und kleiner Schießscharten sind im Mauerwerk verschiedentlich vorhanden. Die Südostecke der Wehrmauer bildet ein Bollwerk, ein nach der Außenseite zu halbrunder Turm mit zwei Schießscharten. (Abbildung Nr. 17). In unmittelbarer Nähe davon ist in der Ostmauer, der Angriffseite, noch der Unterbau (Platte) einer sogenannten Pechnase *) erhalten. Dort trennte jedenfalls noch ein Graben einst die Mauern vom Berggelände. In der Nordostecke schlingt sich ein uralter Epheustock heute an die Wehrmauer. Als Entstehungszeit der Befestigungsanlage kann das 15. Jahrhundert angenommen werden.

Abbildung 17 - Wehrmauer mit Bollwerk um die Kirche
Der Boden des gegenwärtig nicht mehr benützten Gottesackers um die Kirche besteht gegen die Bergseite zu meist aus dem Schutt der nach und nach eingestürzten Mauern **) und ist teilweise durch niederen Maueraufbau von dem vorderen Teil der Anlage abgetrennt. In der südlichen Ecke der kleinen Innenmauer beim Chor befindet sich ein Stein, an dem die Jahreszahl 1746 und die Zeichen MN erkennbar sind. In diesem Teil des alten Friedhofs steht auch das schon erwähnte Kriegerdenkmal von 1914 / 18. Gegen die Dorfseite ist innen an der Wehrmauer, dem Kirchturm gegenüber, ein Stein eingelassen, der 2 Wappen nebeneinander, den badischen Schrägbalken und einen Adler zeigt. Es handelt sich jedenfalls um die Wappen des Markgrafen Friedrich V. von Baden und seiner fünften Gemahlin Elisabeth Eusebia, einer geb. Gräfin von Fürstenberg (vermählt 1649).
Dieser Wappenstein (Renaissance-Arbeit) bildete früher (nach Bürklin 1734) die Krönung des "kleinen Portals im Eingang des Kirchhofs". Es kann damit das Portal an der Kirchstaffel gemeint sein oder es bestand ein zweites in der Mauer beim Beckenrain an der Stelle des heutigen Tores.
Hieraus läßt sich schließen, daß nach dem 30jährigen Krieg die Kirche und die Friedhofbefestigung in zerstörtem Zustande waren und zwischen 1649 und 1659 unter Markgraf Friedrich V. wieder instand gesetzt wurden.
Damals war der neue Friedhof außerhalb der Wehranlage und an diese anschließend schon angelegt. Der Haupteingang dahin am Beckenrain hat einen Rundbogen mit der Jahreszahl 1613 ohne weitere Beizeichen. Dieser neue Friedhof ist verschiedentlich, letztmals in den 1850er Jahren, erweitert worden. Der alte Kirchhof innerhalb der Mauern aber, der sog. Gottesacker, der durch den Choranbau um 1500 eine wesentliche Verkleinerung erfahren hatte, wurde in seinem östlichen Teil noch bis ins 19. Jahrhundert weiterbenützt, insbesondere wurden da, wie es im Jahr 1765 einmal heißt, "lauter Leuthe begraben, die man nicht in den Kirchhof legen kann", also Verbrecher, Selbstmörder, fahrendes Volk aber sonst Fremde. Ehre und Stolz der Bürger und Bauern hielt damals sehr auf reinliche Scheidung, selbst im Tod.
Solche Bestattungen von "Nichtehrbaren" mußten zwischen 1796 und 1798 (Heeresdurchzüge) ziemlich zahlreich gewesen sein, denn auf dem engen Raum zwischen Chor und Wehrmauer machte sich zu dieser Zeit der Leichengeruch so bemerkbar, daß man in eine Untersuchung eintrat, "wie die eingeschlossenen Dünste der Gräber fortzuschaffen wären". Es wurden dann in die Wehrmauern gegen Norden 4 - 5 Zuglöcher eingebrochen, die heute noch zu sehen sind. Häufig nötig waren im Lauf der Zeiten die Ausbesserungen an der Befestigungsanlage, die seit einem Jahrhundert etwa ihrem ursprünglichen Zweck als Schutz- und Verteidigungsort nicht mehr dienen konnte. Viele Reparaturen erforderte früher namentlich die Kirchenstaffel, weil durch das häufige Auf- und Abschleppen von Hausrat, Kisten und schweren Fässern nach und aus der sicheren Kirchenbefestigung die Steinstufen jeweils stark mit genommen wurden.
Im Jahre 1824 sollte die nördliche Befestigungsmauer abgetragen werden, und wiederholt wollte die Gemeinde die ganze Wehranlage abbrechen, doch gelang es immer noch, die Einwohner davon zu überzeugen, welch wertvolle Sehenswürdigkeit sie an ihrer Kirchenburg haben, die zu erhalten und zu bewahren eine vornehme Pflicht der ganzen Gemeinde in alle Zukunft sein müsste. Soweit hierfür der Staat auch in Frage kommt, dürfte die Gemeinde auf sichere Unterstützung rechnen können.
*) Die Platte mit der runden Öffnung kann nicht gut als Abort betrachtet werden, da man derartige Einrichtungen beim Festungsbau gewöhnlich nicht an der Angriffsseite errichtete.
**) Anhaltspunkte dafür, daß die Befestigung gewaltsam zerstört wurde, etwa z. Zt. der Franzosenkriege 1689 / 94, sind nicht vorhanden.
Die Andreaskirche
Der Überlieferung nach soll die Kirche im Jahr 1410 erbaut worden sein. Urkundliche Belege darüber fehlen. Daß schon vorher eine Kirche vorhanden war, ist zweifellos, da in Frauenalber Klosterurkunden vom Jahr 1329 ein Heinricus plebanus (Pfarrer) in Duthelingen erwähnt wird.
Das Jahr 1410 kann für den Beginn des Umbaus der älteren Kirche unter gleichzeitiger Errichtung der Wehranlage angenommen werden. Turm und Langhaus dürften in ihren untersten Teilen (Grundmauern) noch Reste dieser älteren, aus romanischer Zeit (etwa 1250 - 1300) herrührenden Kirche sein, die ihren Chor im Turm hatte. Der Umbau zur gotischen Zeit brachte erst den Eingang am Turm und den Anbau des heutigen Chors, der etwa in das Jahr 1500 - 1510 zu setzen ist.
Die Kirche war dem heiligen Andreas *) geweiht, daher auch das Andreaskreuz im Dorfwappen. Das Gotteshaus steht, wie alle alten Kirchen, in Ost-Westrichtung, der Turm im Westen am steil abfallenden Hügel. Der massige quadratische Turm ohne Sockelgesims hat an seiner Vorderseite eine Türe mit frühgotischem, sog. gleichseitigem Spitzbogen. Die alten steinernen Türangeln sind noch vorhanden, wie auch ein Sperrbalkenloch. Zu beiden Seiten dieser Türe waren außen die schon erwähnten römischen Reliefsteine eingemauert.
Der Turm hat auf den drei freien Seiten im Unterstock je eine schießschartenähnliche, schmale und schräg gerichtete kleine Öffnung, im zweiten Stock ein schief nach West-Ost gestelltes Ausguckfenster (Schießscharte), in seinem obersten Geschoß bei den Glocken außer den zwei kleinen viereckigen Fensteröffnungen drei große Doppelfenster. Zwei davon haben im Einzelnen den runden Bogen, das dritte, größere, ist durch die Mittelsäule in zwei viereckige Lichten geteilt, über denen ein runder Hauptbogen liegt. Die Ecken der beiden Lichten sind nach innen ausgebogen. Die Turmspitze besteht aus einem großen Knopf mit Kreuz und Hahn.
Das Innere des Turms ist heute nach dem Langhaus zu in den beiden untersten Stockwerken offen. Das dritte Geschoß (in der Höhe der heutigen Langhausecke beginnend) liegt im Speicher, wo die Spitze eines die ganze Breite des Turmes einnehmenden gotischen Bogens vorhanden ist, der auf dem zweiten Geschoß aufsitzt. Über dieser offenen Bogenspitze, die den Zugang vom Turm zum Langhausspeicher bildet, führt eine mit breitem geschweisten Kielbogen ausgestattete kleine Türe, heute durch eine Holztreppe erreichbar, in den Glockenstuhl.
Die Fenster, die gotische Türe und der breite Spitzbogen des Turmobergeschoßes sind erst Ende des 16., anfangs des 17. Jahrhunderts eingesetzt worden, vermutlich als die Turmspitze und der Glockenstuhl erneuert wurde, wenn nicht damals überhaupt erst das ganze Obergeschoß neu aufgebaut wurde. Die Möglichkeit, daß Langhaus und Turm ursprünglich unter einem Dach waren, wie es bei vielen befestigten, alten Kirchen der Fall war, liegt auch bei der Dietlinger Kirche vor.
Die Langhausecke dürfte ehedem höher gelegen haben. Ihre letzte Verlegung erfolgte wohl mit dem Neubau des ganzen Dachstuhls im Jahr 1785, als das Kirchenschiff auf der Nordseite erweitert wurde. Schon 1732 drohte die Decke übrigens einzufallen, sie wurde aber damals wieder notdürftig instand gesetzt. Bei dem Umbau des Dachstuhls verschwanden dann auch die "Gaden" (kleine Kammern) im Kirchenspeicher, worin die Dietlinger Bürger ihre wertvollste Habe bargen, wenn sie zu Kriegszeiten und bei feindlichen Überfällen in ihre befestigte Kirche flüchten mußten.
Außer dem aus schweren Eichenbalken bestehenden alten Glockenstuhl (um 1600) enthält das Turmobergeschoß auch das Kirchenuhrwerk.
Dietlingen hatte schon vor Jahrhunderten 3 Glocken; in den französischen Raubkriegen am Ausgang des 17. Jahrhunderts wurde das ganze Geläute vom Feinde weggeführt. Um 1695 beschaffte man wieder zwei Glocken von 550 und 175 Zentnern auf Ortskosten, zu denen aus Anlaß der Kirchenerweiterung im Jahr 1785 eine dritte hinzugekauft werden sollte, wozu aber die Herrschaft die Unterstützung versagte und auch die Genehmigung nicht erteilte.
Als im Jahr 1800 am 23. August die große Glocke zersprungen war, wurden dafür zwei neue von Neubert in Ludwigsburg im Jahr 1801 angeschafft, wobei die zersprungene Glocke umgegegossen wurde. Die Kosten von 1320 fl. brachten die Bürger durch freiwillige Beiträge auf. 1805 zersprang auch die alte kleine Glocke. Erst 1858 wurde wieder eine neue dafür beschafft.
Diese drei Glocken läuteten bis zum Jahr 1917 miteinander. Der Weltkrieg forderte die zwei kleineren als Opfergabe eine; am 21. Juni 1917 erklang das Schlußgeläute und am 24. Juni hielt die Gemeinde bei der Kirche eine Glockenabschiedsfeier, wobei der Ortsgeistliche, Pfarrer Horr, seiner Rede die Worte Johannes 11, Vers 28 zu Grunde legte: "Der Meister ist da und rufet dir!"
Die der Gemeinde verbliebene große Glocke von 1801 hat folgende Inschrift: Vorderseite: "Dietlingen Oberamts Pforzheim. Damals waren Herr C. F. Rink Pfarrer; H. M. Eberle Schultheis, H. D. Bischoff Anwald; H. J. Birkle Schulmeister." Rückseite: "Gegossen von C. G. Neubert in Ludwigsburg 1801. Carl Friedrich Markgraf von Baaden."
Fünf Jahre lang läutete diese Glocke allein zu Dietlingen. Im Jahr 1922 beschaffte die Kirchengemeinde wieder Ersatz für die beiden im Krieg abgelieferten Glocken aus der Glockengießerei Bachert in Karlsruhe. Am 4. Juni 1922, am Pfingst-Sonntag, war Glockenweihe und seither erschallt wieder ein schöner Dreiklang (Fis-A-Cis) von der alten Kirche zur Freude der Gemeinde. Die mittlere Glocke (Heldenglocke) trägt die folgende Widmung: "Unseren im Weltkrieg gefallenen Brüdern zu Ehren und Dank. Wie sind die Helden gefallen. Der Tod ist verschlungen in den Sieg!" Die kleine Glocke (Vaterunserglocke) hat die ehernen Worte: "Friede auf Erden!"
Zu Anfang des 18. Jahrhundert ist eine Uhr am Kirchturm nachweisbar, sie wird wohl schon etwas früher vorhanden gewesen sein. Im Jahr 1788 musste die Turmuhr, die gar vieler Ausbesserungen bedurfte, ganz außer Gebrauch treten. Der Uhrmacher Dinkelmann aus Pforzheim lieferte der Gemeinde dann im Jahr 1790 eine neue gegen Überlassung des alten Werks und Zuzahlung von 98 fl. nebst 2 fl. 30 Kr. Trinkgeld. Von dieser Uhr ist heute nur noch das Zifferblatt erhalten, Zeiger und das ganze Uhrwerk wurde 1905 vollständig erneuert. Als im Weltkrieg die kleinen Glocken fehlten, wurden zum Ersatz Eisenbahnschienen angebracht, auf denen der Uhrhammer die Viertel- und Halbstunden anschlug. Eine alte Sonnenuhr befand sich an der Südwand des Kirchturms. Sie wurde in den letzten Jahrzehnten bei einer Erneuerung der Kirche entfernt.
Das Langhaus hat seit dem Umbau von 1785 nichts mehr von seiner Ursprünglichkeit bewahrt. Es war vor seiner Erweiterung sehr klein und reichte schon 1746 nicht mehr für die Kirchenbesucher aus. Damals bat die Gemeinde den Markgrafen, in der Kirche jeweils "aus 3 Stühlen vier machen zu lassen, weil die Weiber und Kinder beim Gottesdienst größtenteils stehen müßten." Von da an kamen die Bestrebungen für einen Kirchenausbau nicht mehr zur Ruhe; immer aber scheiterten sie an der Markgräflichen Regierung, bis 1785 die erwähnte Vergrößerung genehmigt wurde.
Das Gestühl und die Emporen des Kirchenschiffs stammen in der Hauptsache aus den Jahren 1760 und 1785. Der Altar (aus Holz) ist neu; das Kruzifix darauf, handwerklich einfach, einige Jahrzehnte alt. Der romanische Taufstein, kelchförmig aus einem Sandsteinblock herausgearbeitet, ist ohne besondere Zieraten und Zeichen. Er stammt jedenfalls noch aus der ersten Kirche Dietlingens und bildet so das älteste und ehrwürdigste Stück aus der kirchlichen Vergangenheit des Dorfes. Aus Sandstein, viereckig und einfach bearbeitet, mit spitzem Untersatz, ist auch die an der Ostwand neben dem Chorbogen angebrachte Kanzel, deren Errichtungszeit wohl mit der Erbauung des Chors zusammenfällt. Ihren Zugang hat sie vom Chor aus. Der Schalldeckel mit ausgemalter Taube ist klassizistisch.
Im übrigen ist das Langhaus schmucklos und kahl. Der nüchterne Eindruck wird noch durch die viereckigen, gewöhnlichen Fenster verstärkt, die anläßlich des Umbaus an die Stelle der früher vorhandenen schmalen gotischen Fenster traten. In der Südwand ist noch eine alte kleine Nische erhalten geblieben. Ehedem war das Innere der Kirche reich mit Holzfiguren und Bildern geschmückt, die nach der Reformation entfernt, aber noch lange im Speicher und Glockenstuhl aufbewahrt wurden, wo sie 1734 noch der Pforzheimer Superintendent Bürklin sah und als Merkwürdigkeit verzeichnete. Heute ist alles verschwunden. Unter der Tünche der ganzen Kirche, namentlich im Untergeschoß des Turmes, dem alten romanischen Chor, sind noch Malereien vorhanden, deren Farben, soweit festgestellt, aber so stark verblichen sind, das sich eine weitere Aufdeckung nicht mehr lohnen dürfte.
Ein einfacher, breiter gotischer Bogen leitet vom Langhaus über zu dem an die ehemalige Abschlußwand der romanischen Kirche angebauten Chor. Daß die Spitze des Bogens heute in die Langhausdecke hineinreicht, mag auch ein Zeugnis dafür sein, daß diese Decke einst höher lag.
Der Chor, der die Hälfte eines Achtecks darstellt, enthält ein dreiteiliges und drei zweiteilige gotische Fenster, davon das östliche vermauert, mit Maßwerk in Herzform, Fischblasen und Dreipaß. Einige alte Butzenscheiben haben dem Zahn der Zeit noch standgehalten. Ein rundbogiges großes Fenster (Nordseite) und zwei kleinere viereckige sind nachträglich eingebrochen worden. Wie Turm und Langhaus ist auch der Chor an der Außenseite ohne Sockelverkleidung und Fußgesims. Das einfache, holgekehlte Kranzgesims des Langhauses ist auch beim Chor angewendet. Die Decke des Chors ist aufgelöst in ein stark verästeltes Netzgewölbe, dessen Rippensystem durch zwei Schlußsteine zusammengefaßt wird. Von diesen hat der eine ein Wappenschild mit Spuren älterer roter und grauer Bemalung, der zweite runde Schlußstein mit neuerem farbigen badischen Wappen trägt in gotischen Buchstaben die Umschrift: "Qui est ex deo verba dei audit." (Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes.) Die schlanken, auf zwei Seiten ausgekehlten Gewölberippen laufen in den Ecken aus in 8 Konsolsteine, von denen einer an der Südwand ein Wappenschild trägt (heute Baden aufgemalt), die andern kegelförmig ausgestaltet sind. Die Rippen waren einst rot bemalt, dagegen hat sich in den Rippenfeldern keine Malerei gezeigt. Nord- und Westwand des Chors aber tragen unter der Tünche Spuren alter Bemalung. Die Schönheit des Chors mit seinem Netzgewölbe kommt jedoch nicht zur Wirkung, weil die Orgel den ganzen Raum ausfüllt.
Schon im 17. Jahrhundert hatte Dietlingen eine Orgel, die im Chor stand. Sie war 1739 so unbrauchbar, daß das Gestell abgebrochen wurde. Im Jahr 1748 erhielt die Kirche dann eine neue Orgel mit 6 Registern, die von Christoph Müller, ehemals in Pforzheim, dann in Unterriexingen, geliefert und aufgestellt wurde. Ihr Preis betrug 160 fl. Drei weitere Register baute im Jahr 1785 der Orgelmacher Stein von Durlach für 145 fl. in die Orgel ein, doch war das Instrument im Jahr 1819 nicht mehr gebrauchsfähig und die Gemeinde schaffte wieder eine neue Orgel an. Die Hoforgelbaumeister Gebrüder Stiefel von Rastatt lieferten für 1450 fl. im Jahr 1821 die heutige Orgel mit 13 Registern und nahmen die alte dabei in Zahlung. 1785 schon und wieder bei Anschaffung der neuen Orgel erwog man ihre anderweitige Aufstellung, etwa im Turmgeschoß oder auf der Seite des Langhauses, um den Chor frei zu bekommen, aber das Vorhaben wurde bedauerlicherweise nie durchgeführt. Hoffentlich geschieht dies bald, denn die Kirche würde fraglos durch die Freilegung des Chors bedeutend gewinnen.
Als Sakristei dient lediglich ein Verschlag im Chor.
Der alte Opferstock aus Holz mit schweren, eisernen Beschlägen (15./16. Jahrhundert) wird heute auf dem Kirchenspeicher aufbewahrt. Was die sonstige Ausstattung der Kirche, Kirchenschatz und Altar- sowie Kanzelbekleidung anbetrifft, so war es damit infolge der fast immerwährenden Kriegszeiten im 17. und 18. Jahrhundert recht schlecht bestellt. Wertvolles war öfters geraubt worden, Kanzel- und Altardecken, vom Alter morsch geworden, oder, wie 1741 "von Schaben zerfressen", konnten wegen der Not der Zeiten nicht erneuert werden. Man setzte hierzu die Hoffnung auf Mildtätigkeit fürstlicher Personen. So stiftete auch tatsächlich die Prinzessin Katharina Barbara von Baden, die unvermählt gebliebene Tochter des Markgrafen Friedrich VI., in den 1730er Jahren zwei neue "Kirchenbekleidungen" in die Dietlinger Kirche. Von den älteren Kirchengeräten, den Tauf- und Abendmahlskannen und Kelchen aus Silber und Zinn, wie sie im 17. und 18. Jahrhundert vorhanden waren, sind nur die zwei zinnenen Abendmahlskannen (mit Osterlamm auf den Deckeln) erhalten. Sie tragen beide am Fuß die Inschrift: "Das ist mein Blut, für Eure Sünden vergossen". Dazu gehört eine Platte, gleichfalls aus Zinn. Alle übrigen Gefäße: 2 silberne Kelche für Abendmahl, 1 silberne Taufkanne mit Schüssel, 1 silbernes Taufkännchen für Haustaufen, 1 silbervergoldeter Krankenkelch sind aus neuerer Zeit.
Die Dietlinger Kirche ist heute im Verhältnis zur Einwohnerzahl zu wenig geräumig. Wiederholt ist, wie schon im 18. Jahrhundert, auch in den letzten Jahrzehnten die Neubaufrage erörtert worden. 1838/41 wollte man die Kirche sogar abreißen, der Plan für eine neue war schon fertig. Man beschränkte sich aber auf eine Erneuerung außen und innen, wobei das Gestühl vergrößert wurde. Auch 1891 und 1900/02 erhielt die Kirche in ihrem Innern und Äußern einen neuen Anstrich.
Es wäre zu wünschen, daß, wenn je ein Kirchenneubau notwendig werden sollte, dann ein vollständig neues Gotteshaus an anderer Stelle des Ortes erstehen möge, die alte, ehrwürdige Dorfkirche aber mit ihrer Befestigungsanlage unangetastet bleibe und weiter als Kunstdenkmal sorgsam bewahrt werde.
*) Der heilige Andreas, der, ehe er Christus als Jünger folgte, Fischer war, wurde daher in erster Linie Schutzpatron der Fischer, dann der Metzger und Seiler. Er wurde auch als Helfer im Kampf mit dem Feind, sowie gegen Gicht und Halsweh angerufen und von alten Jungfern, die einen Mann bekommen wollten, besonders verehrt, wie er auch als Patron gegen den "bösen Blick alter Weiber" galt. Andreas (der Mannhafte) war überhaupt im 13. / 15. Jahrhundert ein sehr populärer Heiliger. Nach der Legende erlitt er an einem schrägen Kreuz den Märtyrertod. Sein Gedächtnistag ist der 30. November. Die vorhergehende Andreasnacht spielt im Volksglauben eine Rolle, indem in der Nacht die jungen Burschen und Mädchen ihre Zukünftigen durch allerhand Gebräuche zu erfahren hofften. Das Kirchweihfest zu Ehren des Ortsheiligen Andreas wurde zu katholischen Zeiten noch im November gefeiert. Später mehrfach verlegt, wird jetzt die Kirchweihe im Oktober gehalten.
Anmerkung der Redaktion: fl. = Gulden / Kr. = Kreuzer
Pfarrei und Pfarrhaus
Die einst zum Bistum Speyer zählende Pfarrei und die Frühmesspfründe an der Kirche wird schon im 14. Jahrhundert erwähnt und wurde von der Ortsherrschaft, den Straubenhardt, später den Leiningen-Westerburg, vergeben. Im Jahr 1473 ging der Pfarrsatz, wie schon gesagt, durch Kauf des Dorfes an Baden über. Bald darauf wurde die Pfarrei dem St. Michaelstift Pforzheim einverleibt. Im 15. / 16. Jahrhundert wird neben dem Pfarrer immer auch ein Frühmesser genannt, der die besondere Pfründe bezog. Die Pfarreieinkünfte bestanden aus dem 6. Teil des großen Zehnten und des Weinzehnten, sowie aus 2/3 des kleinen Zehnten (seit 1690=1/3). Letzterer erstreckte sich nicht nur auf Obst, Erbsen, Linsen und Rüben, sondern auch auf Vieh. So erhielt der Pfarrer bei einem Kalb 1 Heller, bei einer Geiß ein Ei, von Schweinen und Lämmern das zehnte.
Der Heuzehnte warf 1 Heller vom Morgen Wiesen ab. Die sonstige Besoldung war 60 fl. Geld, 7 Malter Roggen, 16 Malter Dinkel, 10 Malter Hafer, 2 Malter Gerste, 10 Ohm Wein, Brennholz lieferte der Gemeindewald. An Gebühren bezog der Pfarrherr 1 fl. für eine Hochzeitspredigt, 20 Kreuzer für eine Kindstaufe, 1 fl. für eine Leichenpredigt.
Der Pfarrer hatte Haus, Scheune und Garten, er war ferner im Besitz des Widdumgutes, wofür der Pfarrhof aber die Haltung der 2 - 3 Tafelochsen und der 2 Eber übernehmen musste. Diese Verpflichtung fiel um 1750 weg, als der Gemeinde das Widdumgut im Vergleichsweg überlassen wurde. Im Jahr 1800 aber entstand darob ein Prozeß, als die Pfarrei das Gut wieder beanspruchte. Wie überall, hatten auch in Dietlingen die Pfarrer, namentlich im 18. Jahrhundert, stets um ihre Zehntanteile zu kämpfen und kamen dadurch gar häufig in Gegensatz zu der Gemeinde oder zur Herrschaft.
Schon aus dem Jahr 1480 wird von einem Zehntstreit berichtet, den der Pfarrer von Dietlingen mit dem Markgrafen Christoph I. führte. Über weitere Zehntansprüche der Pfarrei entstanden in den folgenden Jahrhunderten verschiedene Aktenbestände. 1710 beanspruchte die Pfarrei Gräfenhausen den vom Dietlinger Pfarrer bisher einbehaltenen sogenannten Holderzehnten, der nun verloren ging. Eine tiefgehende Streitigkeit entstand im Jahr 1816 zwischen Gemeinde und Pfarrer Fischer wegen des Kartoffelzehnten, eines Novalzehnten im Salhau. Der Pfarrer wollte den Zehnten in natura haben, die Gemeinde aber bot Geld dafür an. Es kam soweit, daß die Dietlinger ihren Pfarrer boykottierten und nicht mehr zu ihm in die Kirche gingen, ja an Sonntagen jeweils einen Zug bildeten, um am Pfarrhaus vorbei nach Ellmendingen zur Kirche zu ziehen. Das bekam den Dietlingern aber schlecht, die Oberbehörde mußte sich des Falles annehmen, zumal die Ellmendinger diesen Einfall in ihr Dorf keineswegs gerne sahen. Der Streit ging Jahre hindurch, es gab keinen Sieger und keine Besiegten, um so mehr Hader innerhalb der Gemeinde, der auch nicht aufhörte, als 1826 der Pfarrer Fischer eine andere Pfarrstelle übernahm. Mit dem Wandel der Zeiten haben sich auch diese Unstimmigkeiten gelegt und das Einvernehmen zwischen Pfarrer und Gemeinde war im Laufe des vergangenen Jahrzehnts ein gutes.
Das älteste Pfarrhaus stand "jenseits des Bach, stoßt an den Widdemgarten", wie es in Berainen des 16. Jahrhunderts beschrieben wird. Es war wohl das Haus, wegen dessen Unterhaltung im Jahr 1473 Pfarrer Leisch gegen den damaligen Ortsherrn, Reinhard von Westerburg, Klage führen musste. Der Bischof Mathias von Speyer verglich die Sache dahin, daß die Ortsherrschaft 15 fl. zum Bau leistete. Das alte Pfarrhaus wurde 1666 als baufällig abgebrochen und an dem Platz der Pfarrgarten (heute überbaut in der Nähe der Steinbrücke) angelegt. Als Pfarrwohnung wurde dann in der Hofgasse einer der Herrschaft im 30jährigen Krieg heimgefallene verlassene Hofstätte mit Bauernhaus hergerichtet. Dieses Pfarrhaus war in den 1730er Jahren dem Verfall nahe und verschiedentlich (1732, 1739, 1746) wurden größere Ausbesserungen daran vorgenommen. Im Jahr 1754 wurde dann ein Neubau genehmigt, wozu der Markgräfliche Baumeister Arnold die Pläne entwarf. Der Überschlag lautete auf 1502 fl. Das bisherige Pfarrhaus wurde abgerissen und es erstand 1759 an der gleichen Stelle der heute noch als Pfarrhaus dienende zweistöckige, von einem großen Hof umgebene Bau. Die Jahrzahl der Errichtung befindet sich über der Eingangstüre. (Abbildung Nr. 18)

Abbildung 18 - Pfarrhof und Krämer´sches Fachwerkhaus
Zu den Obliegenheiten eines Pfarrers gehört die Führung der Kirchenbücher, die im allgemeinen mit der Reformation eingeführt wurden. Die Dietlinger Kirchenregister beginnen mit dem Jahr 1607 unter Pfarrer Johannes Köler (Köhler). Unter der Obhut des Pfarrers und des Kirchengemeinderates steht der kirchliche Almosenfonds. Er gehörte früher ins fürstliche Waisenhaus zu Pforzheim. Im 18. Jahrhundert war er lange Zeit so gering, daß das Rechnungstellen darüber, wie ein Protokoll sagt, mehr Kosten verursachte, als an Zinsen einging. Zuvor, im Jahr 1699 beispielsweise, waren im Fonds, dem auch ein Orgelfonds angeschlossen ist, merklich und wahr bis zum Weltkrieg 1914 auf 21000 Mark angewachsen.
Die Reihe der Dietlinger Pfarrer ist lückenlos erst seit 1600 bekannt. Aus der katholischen Zeit bis zur Reformation und unmittelbar nach dieser fehlen nähere Nachrichten über die Geistlichen des Dorfes:
1328
Heinrich
1473
Leisch
1607
Johann Köhler
1609
Berthold Schmuck
1610
Bitus (Benantius) Roth
In der Folgezeit wird die Pfarrei von Vikaren und Nachbarpfarrern versehen.
1653
Christoph Braun
1662
Joh. Mitschdörfer
1675
Berthold Deimling
1691
Imanuel Rösch
1694
Joh. Mitschdörfer (2. Mal)
1697
Ant. Gottl. Desselius
1721
Joh. Griesbach
1722
Joh. Gg. Schlosser
1746
J. F. Hauber
1758
K. W. Krüger
1760
J. Chr. Deimling
1777
L. J. Hartmann
1790
Chr. Fr. Rink
1804
Ph. W. Ludwig
1807
Fr. L. Fischer
1826
G. F. Euler
1840
J. H. Frank
1863
H. Fuhr
1865
Joh. L. Reinmuth
1875
Chr. Im. Leutwein (Abb. 19)
1897
Adolf Kölsch
1904
Eduard Gebhard
1910
Friedrich Horr
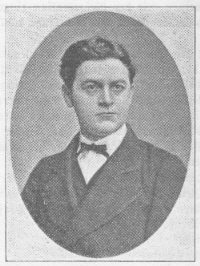
Abbildung 19 - Chr. Im. Leutwein
Pfarrer in
Dietlingen von 1875 - 1897
Eines kirchlichen Amtes wäre noch zu gedenken: des Meßnerdienstes. Der Meßner der Dietlinger Kirche hatte eigentümlicherweise einen besonderen Zehnten; auch vom kleinen Zehnten stand von alters her dem Meßner von Dietlingen (auch Ellmendingen) ein Teil zu, wofür aber das sogenannte "Meßnermahl" alljährlich zu geben war für Schultheiß und Gerichtspersonen. Im Jahr 1651 zog die geistliche Verwaltung den Meßnerzehnten von Dietlingen an sich und setzte dafür eine Besoldung aus von je 3 Malter Roggen, Dinkel und Hafer und für den kleinen Zehnten 2 fl. an Geld, welcher Betrag nun gleich der Gemeinde gutgebracht wurde, die den Meßner bestellte. Damit hatte der uralte Brauch des Meßnermahls sein Ende gefunden. Die Meßnereinkünfte wurden anfangs des 18. Jahrhunderts auf 5 Malter Roggen, je 4 Malter Dinkel und Hafer, 1 Ohm Wein erhöht. Außerdem bezog der Meßner 13 1/2 Kreuzer für das Aufziehen der Kirchenuhr, ferner war ihm das Gras und Obst vom Kirchhof überlassen. Von Martini bis Mathäi mußte der Meßner abends um 9 Uhr gemäß altem Herkommen läuten, wofür er einen Laib Brot zu beanspruchen hatte. Das Neunuhrläuten besteht heute nicht mehr, es wird jetzt der Morgen und der Abend täglich mit der großen Glocke eingeläutet.
Von einer Kindstaufe und Kindsleiche erhielt der Meßner je einen Laib Brot von 6 Pfund, von einer Beerdigung von Erwachsenen 2 1/2 Kreuzer nebst 6 Pfennig Läutlohn, für Leichengesang 15 Kreuzer, von der Abdankung 15 Kreuzer. Den Meßnerdienst versah Jahrhunderte hindurch der jeweilige Lehrer (damals Schulmeister genannt) des Dorfes, wie das früher allerorts üblich war. Heute ist ein besonderer Kirchendiener dafür angestellt.
Anmerkung der Redaktion: fl. = Gulden / Kr. = Kreuzer / 1 Ohm Wein = 150 Liter / 1 Malter = 100 Liter / 1 Malter Roggen = 75 kg / 1 Malter Dinkel = 70 kg / 1 Malter Hafer = 58 kg.
Kirchliches Leben
Getreu nach den von den Vorfahren her übernommenen Glaubensgrundsätzen wickelt sich das religiöse Leben der heutigen Dietlinger in stiller und würdiger Weise ab. Wir früher schon immer das Dorf sich einer guten Kirchenzucht rühmen konnte, so möchte die Einwohnerschaft der Gegenwart dieses Zeugnis auch nicht vermissen. Der Kirchenbesuch ist ein guter und Pfarrer und Kirchenälteste werden stets hoch geachtet. Und das ist gut so und ehrt die Gemeinde im Innern und nach Außen.
Rückblickend auf das kirchliche Leben in vergangenen Jahrhunderten tritt als Hauptereignis die religiöse Bewegung in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts hervor, die eine Glaubensspaltung in der alten Kirche im Gefolge hatte: die Reformation. Sie setzte sich in Dietlingen unangefochten und vollständig durch, da die Landesherrschaft Baden und auch die benachbarte, in Dietlingen noch einflußreiche Herrschaft Württemberg sich der evangelischen Konfession zugewandt hatten. Diesem Bekenntnis blieben die Dietlinger auch in der kritischen Zeit des dreißigjährigen Krieges treu, als das ganze Amt Pforzheim 1635/42 von Bayern besetzt war und versucht wurde, die Bevölkerung zum Katholizismus zurückzuführen.
Bekannt ist der glaubensstarke Widerstand von Dorf und Stadt des Amtes, als die "Papisten" die Kirchen verschlossen und die Pfarrer vertrieben. Nur 3 Landpfarrer waren noch im ganzen Amt, darunter der Brötzinger, welcher die Gemeinde Dietlingen zeitweilig und abwechselnd mit vorübergehend vorhandenen Vikaren geistlich versorgte, doch trug man die Kinder auch nach Gräfenhausen zur Taufe.
Während 12 Jahre, von 1635 - 1647, war kein Pfarrer in Dietlingen und in den Kirchenbüchern sind große Lücken deshalb. Endlich stellte eine Wendung im Kriegsgeschick und der folgende Friede den alten Zustand wieder her. Das Land erholte sich langsam von den harten Schlägen des langen Krieges, der gelockerte Sitten und Gleichgültigkeit im Volke nur zu viel mit sich gebracht hatte. Nachdem auch noch die französischen Raubkriege zu Ende des 17. Jahrhunderts vorüber waren, setzte in der Markgrafschaft das kirchliche Leben wieder überall bessernd ein. Kirchenvisitationen wurden abgehalten. Die Protokolle darüber geben uns von manchem interessanten Einzelheiten kunde. Im Jahr 1698 hielt gleich nach Eintritt des Friedens der Superintendent von Pforzheim, Kirchenrat Kummer, auch in Dietlingen Visitation ab, die nach dem Protokoll "gottlob ziemlich wohl abgeloffen" ist.
Damals lebten im Dorfe etliche katholische Maurer aus Tirol, die in Pforzheim arbeiteten, die aber der ganz evangelischen Gemeinde "nicht ärgerlich" waren und die sogar fleißige in die Dietlinger Kirche gingen. Auch ein "reformierter" Bürger lebte unter der "lutherisch" gerichteten Einwohnerschaft. Im 18. Jahrhundert fanden noch häufige Visitationen der kirchlichen Verhältnisse und des sittlichen Wandels der Dietlinger statt, die im allgemeinen gute Zeugnisse bringen. Nur im Jahre 1714 hält der Visitator Gericht über die Mädchen, die sich während der Kriegsjahre nicht gut und brav betragen hatten.
Man ging zu früheren Zeiten häufiger in die Kirche als heute. Sonn- und Feiertags war Predigt, im Sommer um 8 Uhr, im Winter um 9 Uhr, des Mittags wieder Gottesdienst und Christenlehre. Dienstags und Donnerstags, wie auch am Samstag fand jeweils um 12 Uhr Betstunde statt. Am Freitag war auch Predigt, abends 1 Stunde nach der Betglocke.
Beim Gottesdienst waren die Kirchenältesten verpflichtet, darauf zu halten, daß alles in Ordnung und Ehren vor sich ginge und insbesondere, daß die Jugend sich züchtig und ruhig verhielte, und niemand in nicht feiertäglicher Kleidung erscheine.
Das Amt eines sogenannten Kirchenrügers wechselte in Dietlingen unter den Mitgliedern des Rats und Gerichts wöchentlich ab. Der Kirchenrüger mußte mit dem Dorfschützen an Sonn- und Wochentagen während des Gottesdienstes im Orte herumgehen und nach faulen Kirchgängern fahnden, die er zur Anzeige zu bringen hatte.
Die Kirchenzucht war überhaupt streng, wie die Zensurbücher in der Pfarrei ausweisen.
Die "Eintürmung" ins "Bürgerhäusle" (Gefängnis im Wachthaus) und Geldstrafen in das Almosen waren zwar die häufigsten Rügen gelinder Vergehen, bei Sünden wider Gott und Gottesdienst aber war man mit anderen Strafen zur Hand, die viel beschämender waren. So erhielt noch im Jahr 1792 der Schneider Sebastian E., der in der Charwoche, anstatt zur Beichte und zum Abendmahl zu kommen, über Feld nach Ersingen ging, um sich dort das "Heilig Grab" in der katholischen Kirche anzusehen, von dort aber betrunken von seinem Sohn heimgeholt werden mußte, folgende Strafe: "Ins Häuslein sogleich, und am Sonntag nach der Kirche vor der Kirchtür stehen mit einem Zettel des Inhalts: Wegen Verachtung der Religion."
Aber im großen und ganzen lauteten die Berichte über das kirchliche Leben der Dietlinger immer günstig, ja im Jahr 1736 wird der Gemeinde besonderes Lob gespendet, daß Predigt und Betstunden wohl an keinem Ort fleißiger besucht werden als in Dietlingen, ferner daß die Vorgesetzten auf gute Ordnung hielten und die Leute auch ganz dazu gewohnt seien. Dem Zechen und Spielen in den Wirtshäusern zwar, das damals einzureißen drohte, wollte man zu begegnen suchen.
Mitte des 18. Jahrhunderts fand zu Dietlingen von Württemberg her ausgehend der Pietismus starken Eingang. Der damalige Pfarrer Hartmann war ein eifriger Verfechter dieser, das kirchliche Leben an sich sehr fördernden Bewegung. Hartmann war Gründer der "Frommen Gesellschaft zu Dietlingen" und schrieb auch eine "Heilsordnung zum Unterricht der Kinder und Konfirmanden".
Im Gegensatz zum Pietismus machte sich anfangs des 19. Jahrhunderts im Dorfe der Separatismus bemerkbar, eine Sekte, die sich wohl von der Kirche trennte, aber nicht förmlich austrat. Die Separatisten hielten ihre Erbauungsstunden unter sich, ließen aber im Todesfalle kirchliche Beerdigung zu und den Pfarrer die Leichenpredigt halten. Am stärksten trat der Separatismus auf nach den Hungerjahren 1816/17 und nach der Kirchenunion 1821. Die Sekte nahm namentlich unter den ärmeren Volksklassen große Ausdehnung an. Damals war ihr Haupt der Leineweber Sebastian Löffler, der vorher als Spielmann und Spaßmacher sich auf Kirchweihen und Hochzeiten betätigte. Infolge eines schweren Schicksalsschlages, der ihm innerhalb vier Wochen Frau und 3 Kinder raubte, wandte sich Löffler dem Separatismus zu und wurde als Führer äußerst fanatisch in seinem Verhalten gegen Kirche und Obrigkeit. Als es aber zu Widersetzlichkeiten gegen den Fürsten und seine Beamten, wie gegen die Geistlichkeit kam, schritt man mit strengen Strafen gegen die Separatisten ein. Mit der Zeit milderte sich der Eifer der Sekte in Dietlingen, auch die Mitgliederzahl verringerte sich. 1876 waren noch 80 Separatisten im Dorfe, heute gehören der Sekte nur noch einige Personen an.
Noch zwei weitere religiöse Gemeinschaften sind in Dietlingen vertreten, wenn auch nur mit wenigen Mitgliedern. Es sind die Wißwässerianer, die sich vom kirchlichen Abendmahl fernhalten und es unter sich feiern, ferner die Irvingianer (kathol.-apostol. Gemeinde), die zu Brötzingen eine eigene Kapelle haben. Bei dieser Sekte wird die Taufe durch die sogenannte "Versiegelung" (Offenbarung des Johannes 7, Vers 4) ersetzt. Der Gottesdienst ist dem katholischen sehr ähnlich, ja noch zeremonienreicher. Wie die Separatisten sind auch die Dietlingen Wißwässerianer und Irvingianer nicht öffentlich aus der Landeskirche ausgetreten.
Außer diesen besonderen Vereinigungen leben im Dorf auch noch einige Lutheraner, die der seit 1821 unierten evangelischen Kirche nicht beigetreten sind. Sie zählen zu der Lutheraner-Gemeinde im Nachbarorte Ispringen.
Die Kinderschule
... Außer der Volksschule sind am Orte zwei Kleinkinderschulen vorhanden, beide geleitet von Schwestern aus dem Mutterhaus zu Nonnenweier. Die ältere, seit 1871 bestehende Kinderschule gehört der Gemeinschaft für Innere Mission Augsburger Bekenntnisses, die zweite ist von der Kirchengemeinde Dietlingen ins Leben gerufen worden. Kinderschwestern sind z. Zt. Wilhelmine Jung und Katharina Waldmann. ...